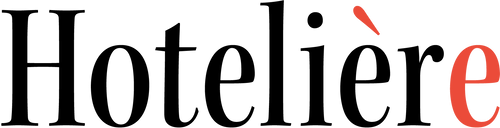Lernende leiden unter Stress. Sie können mit Stress umgehen und bringen ihre Leistung. Dennoch gefährdet Stress die psychische Gesundheit. Das sind die Ergebnisse von zwei aktuellen wissenschaftlichen Studien. Der «Hotelier» hat mit Claudia Züllig und Jamie Rizzi vom Schweizerhof Lenzerheide die Studienergebnisse, ihre Erfahrungen und Massnahmen diskutiert. Spezielle Programme für Auszubildende und deren psychische Gesundheit sind in ihrem Haus eine Selbstverständlichkeit.
Stress bei jungen Menschen. Stress in der Lehre. Der Stress nimmt zu. Das Fazit von zwei aktuellen, repräsentativen Umfragen ist untrüglich: 59 Prozent der jungen Frauen (18–29-jährig) beklagen mehr Stress als vor fünf Jahren. Bei den jungen Männern sind es mit 56 Prozent fast ebenso viele. Im Alltag sehr häufig oder häufig gestresst fühlen sich 49 Prozent der jungen Frauen und 31 Prozent der jungen Männer. Die Gestressten beklagen negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit, und zwar 62 Prozent der jungen Frauen und 48 Prozent der jungen Männer.
Zu diesem Ergebnis kommt eine am 17. Juni im «Sanitas Health Forecasts 2025» publizierte Studie.
Noch drastischer sind die Resultate der repräsentativen Erhebung «Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre», die ebenfalls am 17. Juni 2025 öffentlich präsentiert wurde. Das wichtigste Ergebnis zeigt folgende Zahl: 80 Prozent der Lernenden sagen, dass es ihnen in der Lehre gut oder sehr gut gehe. Befragt wurden 45 000 Lernende in der Schweiz. Es gibt jedoch zwei Aber: Zwei Drittel geben an, unter psychischen Problemen zu leiden. Gar drei Viertel der Lernenden antworteten, die Lehre habe bei ihnen eine psychologische Belastung ausgelöst oder verstärkt. 80 Prozent der Ursachen liegen im privaten Bereich.
Weder dramatisieren noch bagatellisieren
Notschrei und Normalfall, das Studienergebnis steht für beides. Die Studienleiterin vom Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit Work Med, Barbara Schmocker, kommentiert: «Psychische Probleme bei Lernenden müssen vermehrt ernst genommen. Sie sollten aber weder dramatisiert noch bagatellisiert werden. Die meisten Lernenden haben psychische Probleme und wachsen in der Lehre, wenn man sie ernst nimmt.»
Nicht überrascht
«Die Ergebnisse der Stress-Studien überraschen mich absolut nicht», meint Jamie Rizzi, seit 2024 Gastgeber und Mitglied der Geschäftsleitung im Hotel Schweizerhof Lenzerheide. «Die Lernenden bringen ihren Rucksack mit. Das widerspiegelt sich im Alltag. Gerade in der Lehrzeit, die Auszubildenden sind beim Start 15-, 16- oder 17-jährig und durchleben eine entscheidende Phase ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind zwar nicht ihre Erziehungsverantwortlichen, aber wir wollen und müssen sie auf diesem Weg begleiten», sagt Rizzi.
Die Work-Med-Studie brachte an den Tag, dass jene 60 Prozent der Lernenden, die die Lehre belaste, «psychische Probleme im weitesten Sinn» hätten.
Sie reichen von negativen Gedanken und Gefühlen bis hin zu psychischen Krisen und Krankheiten. Auch die Symptome von Depressionen, Angststörungen oder ADHS sind häufig.
Hilfsangebote nutzen
Bedenkenswert ist das Studienergebnis, dass Beratungsangebote an den Schulen oder in den Betrieben von den Lernenden wenig oder nicht genutzt werden.
Claudia Züllig, Gastgeberin im Schweizerhof, die in vielen Berufsjahren zahlreiche Lernende ausgebildet und begleitet hat, weist im Gespräch auf die Bedeutung der Schnupperlehre für die Auswahl von künftigen Lernenden hin. «Die Lernenden kommen als Kinder zu uns und machen dann eine grosse Entwicklung durch: die Ablösung von ihrem Zuhause, das Einfügen in eine neue Umgebung, mit Wohnen im Betrieb und vielen unbekannten Menschen. Sowieso stellen sich viele Fragen und Probleme im Jugendalter – neben der Berufsausbildung.» Aus ihren Erfahrungen nennt sie beispielsweise Herausforderungen wie Bulimie, schwere Akne aber auch die Herausforderung der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, die sich oftmals auch mit der Kleidung (Punk etc.) zum Ausdruck bringt.
Jamie Rizzi ergänzt mit einem dramatischen Beispiel. Ein sehr kommunikativer, junger Mann habe vor der Abschlussarbeit und vor dem Druck der näherkommenden Schlussprüfung Suizidgedanken geäussert. Zudem habe er versucht, das Problem mit Alkohol zu lösen und sei bei der Arbeit nicht mehr verlässlich gewesen. «Weil wir mit ihm unter einem Dach lebten, haben wir seine Situation bemerkt und konnten reagieren. Wir wandten uns ans Bündner Berufsbildungsamt. Wir sind keine Psychologen und benötigten Hilfe.» Es kam zum Kontakt mit der Stiftung «Die Chance», die junge Menschen zwischen 15 und 22 Jahren, die sich in schwierigen, sie belastenden Situationen befinden, mit fachlicher Begleitung unterstützt. Die Stiftung will für Jugendliche die sozialen Voraussetzungen schaffen und sie bei ihrer «Integration in die Berufswelt und damit in die Gesellschaft» unterstützen.
Claudia Züllig und Jamie Rizzi, Gastgeber im Schweizerhof Lenzerheide, haben seit Jahren grosse Erfahrung in der individuellen Betreuung von Lernenden im Chat-Gespräch mit Hotelier-Chefredaktor.
Hilfsangebote nicht nutzen
Wenn Hilfsangebote von Lernenden nicht genutzt werden, das zeigen die Erfahrungen von Jamie Rizzi und Claudia Züllig, kann das viele Gründe haben. «Es braucht Mut, mit einem Problem zu jemandem zu gehen, den man nicht so gut kennt», erläuterte Claudia Züllig. Im Schweizerhof hat das Team der Lernenden jeden Monat einen gemeinsamen, fixen Termin mit einem externen, psychologisch kompetenten Coach. Ein früheres wöchentliches Angebot, bei dem der Schweizerhof und zwei weitere Hotels in Lenzerheide ein professionelles Coaching für alle Mitarbeitenden organisierten, wurde nach zweieinhalb Jahren eingestellt. «Es wurde zu wenig in Anspruch genommen», stellte Claudia Züllig nüchtern fest. Eine Coachin stand dem ganzen Team an einem Tag pro Woche zur Verfügung, was einem zu grossen Angebot bzw. einer zu kleinen Nachfrage entsprach. Die Lernenden hatten einen verpflichtenden, wöchentlichen Termin bei der Coachin, was auch nicht von allen Lernenden im selben Masse geschätzt wurde.
Permanentes, anonymes Beratungsangebot
Es hat sich gezeigt, dass ein eingeschränktes, terminiertes psychologisches Supportprogramm nicht einem Bedürfnis entspricht. «Das Angebot muss immer da sein, wenn man es braucht und nicht nur am Mittwoch», sagt Jamie Rizzi. Weil die betriebliche Gesundheit der Schweizerhof-Führung ein wichtiges Anliegen ist, engagiert man die Firma Movis. Sie ist spezialisiert auf das betriebliche Gesundheitsmanagement oder wie es in ihrem Slogan heisst auf «das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Menschen in der Arbeitswelt». Die Dienstleistungen für die Mitarbeitenden erbringt Movis anonym. Der Schweizerhof Lenzerheide bezahlt einzig die Rechnung. Einmal im Jahr bekommt die Geschäftsleitung eine anonymisierte Zusammenfassung zu den aufgetauchten Fragestellungen oder Problemen, sofern die Mitarbeitenden Movis dazu die Freigabe erteilt hatten.

Abbruch der Lehre – (k)ein Thema
Auf- und Ab-Gedanken zur Sinnhaftigkeit über das, was man gerade lernt, gehören zur Lehre.
Die Lehre abzubrechen, darüber macht sich die Hälfte der Lernenden in der Ausbildungszeit einmal Gedanken. Fünf Prozent haben diesen Gedanken mehrfach. Aber 80 Prozent brechen die Lehre dann doch nicht ab. Die Studie führt Gründe auf, die für diese Entscheidung genannt wurden, z. B.: «Weil ich nicht aufgeben wollte.» «Weil ich die Lehre unbedingt schaffen wollte.» Die Studie schliesst aus dieser Haltung. Es zeigt, dass bei den Lernenden eine «extrem hohe Widerstandskraft» vorhanden ist. Sie sind «motiviert, Schwierigkeiten zu meistern». Mit anderen Worten: «Jugendliche sind nicht verweichlicht.» Es zeige sich, dass psychische Probleme nicht bedeuten würden, dass Jugendliche nicht leistungsfähig oder nicht zufrieden sind mit ihrer Ausbildungssituation.
In den vielen Jahren ihrer Ausbildungstätigkeit machte Claudia Züllig auch die Erfahrung mit wenigen Lehrabbrüchen. Dabei seien nicht nur psychologische Gründe ausschlaggebend gewesen. Es habe sich die Frage nach dem richtigen Beruf gestellt. Die richtige Berufswahl ist für sie deshalb zu einem zentralen Thema geworden. Sie beginnt mit der Schnupperlehre. Der Schweizerhof Lenzerheide hat dafür einen viertägigen, durchorganisierten, eng begleiteten Prozess entwickelt. Dazu gehören tägliche Feedbacks am Ende jeden Schnuppertages, ein Interview mit Lernenden, ein Abschlussgespräch und ein kleines Geschenk. Zudem plädiert sie für ein Zwischenjahr (wie z. B. ein kombiniertes Sprachen-Au-pair-Jahr) nach den neun obligatorischen Schuljahren. Da werde die Persönlichkeit gefestigt. Claudia Züllig erläutert, warum sie zu dieser Überzeugung kam: «Mit dem Einstieg in die Lehre beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Immer Leistung zu bringen und häufig Situationen mit schwierigen Gästen oder fordernden Vorgesetzten zu bestehen, ist eine grosse Herausforderung für die jungen Menschen.»
«Lernende sind die wichtigsten Mitarbeitenden»
Züllig erachtet eine zweite Schnupperwoche im möglichen Lehrbetrieb als sehr sinnvoll. So könne der Berufsentscheid gefestigter getroffen werden. «Es geht in der Hotellerie nicht darum, schnell, schnell Lernende zu verpflichten, sondern die richtigen Lernenden zu finden.» Bei der Unterzeichnung des Lehrvertrages sind im Schweizerhof deshalb auch die Eltern dabei. Es gehe darum, dass alle, auch die Eltern, ein Teil der Lehrzeit seien. Alle müssten Bescheid wissen über Rechte und Pflichten. Aber in der Lehrzeit melde man sich grundsätzlich nicht bei den Eltern. Im Schweizerhof handelt man in diesem Feld nach dem Prinzip «no news are good news». «Wir melden uns nur bei den Eltern, wenn es ernsthafte Schwierigkeiten gibt, die wir gemeinsam mit den Eltern lösen müssen.» Denn für Claudia Züllig ist völlig klar: «Unsere Ansprechpersonen sind die Lernenden. Diese müssen lernen, sich für ihre eigenen Bedürfnisse auch einzusetzen und diese aussprechen können.» Diese Entwicklung bedeutet für Züllig eine der wichtigsten Aufgaben in einer Lehrzeit, denn wir möchten, dass unsere Lernenden nach den drei Ausbildungsjahren als Persönlichkeiten in der herausfordernden Berufswelt erfolgreich sein können. Lernende sind in gewissem Sinne unsere wichtigsten Mitarbeitenden. Sie sind unsere Zukunft».
Die Lernenden in die Berufswelt einzuführen, nicht hineinzuwerfen, dieser Herausforderung stellte sich Claudia Züllig als Gastgeberin des Schweizerhofs in den letzten Jahrzehnten engagiert und erfolgreich. Jamie Rizzi teilt diese Haltung. Konkret beschreibt er seine «Philosophie» zum Berufseinstieg am Beispiel eines Kochlehrlings. Es geht Rizzi darum, den «Übergang von der Schule mit ihrer hohen Fehlertoleranz in den Beruf, ins Geschäft, zu den Forderungen Leistung, Selbstständigkeit und Druck möglichst sanft und individuell zu gestalten». Dem angehenden Koch wurde ermöglicht, im ersten Halbjahr seinen grossen Freundeskreis nach wie vor zu pflegen und nicht am Wochenende arbeiten zu müssen, wenn seine Kollegen freihatten. Es gelang so, die harte Umstellung abzufedern. Zugleich konnte der junge Mann im neuen Umfeld neue Bezüge und Freundschaften entwickeln. Nach dem halben Jahr konnte die Massnahme schrittweise wieder angepasst werden. Danach hat auch er jeweils am Wochenende gearbeitet. Zufrieden zieht Jamie Rizzi Bilanz: «Im Sommer bestand er den Lehrabschluss mit Bravour. Entscheidend war das erste halbe Jahr. Heute fühlt er sich im Beruf mit seinen besonderen Bedingungen wohl. Die Flexibilität hat sich gelohnt.»
Die beiden Gastgeberpaare im Schweizerhof Lenzerheide, von links nach rechts; Jamie Rizzi, Michelle Juker, Claudia Züllig, Andreas Züllig. Individuelle Betreuung, Förderung und Angebote für die Auszubildenden sind in ihrem Haus seit vielen Jahren eine selbstverständliche Priorität.
«Feedback ist eine sensible Sache»
Im Schweizerhof haben fünf junge Menschen am 4. August – bewusst nach dem 1.-August-Trubel im Hotel – ihre Lehre angefangen und in den ersten Tagen ein auf sie zugeschnittenes Einführungsprogramm absolviert: ein Koch mit Autismus, der hier das 2. und 3. Lehrjahr absolviert, eine Restaurations-Fachfrau und ein -Fachmann, eine Hotel-Kommunikations-Fachfrau und eine Fachfrau Hauswirtschaft. Gesamthaft werden im Schweizerhof neun Lernende parallel ausgebildet. Für sie gibt es, begleitend zu den beruflichen Fertig- und Fähigkeiten sowie den berufsschulischen Anforderungen, ein internes, dreijähriges Schweizerhof-Ausbildungsprogramm.
Zum obligatorischen Zusatzprogramm gehören beispielsweise das Kennenlernen von Partnern und Lieferanten, wenn möglich und sinnvoll ein internationaler Austausch – ein Kochlehrling absolviert derzeit ein Praktikum bei einem befreundeten Koch in Schweden – oder das Coaching-Programm mit dem erfahrenen externen Coach Stefan Wiestner. Da werden praxisnahe Themen behandelt, wie Feedback geben und Feedback entgegennehmen. «Eine sehr sensible Sache», sagt Rizzi, «denn Feedback sollte nicht als persönliche Kritik verstanden werden». Trainiert wird auch, wie man vor Leute hinsteht und ein Referat hält. Ebenfalls zum Programm gehört das Thema Resilienz, das in enger Verbindung mit mentaler Gesundheit steht. Wichtig ist, dass im Schweizerhof-Lehrprogramm der Alltag der Lernenden präsent ist. Wie begegne ich Widerständen? Wie gehe ich mit Druck um? Wie verhindere ich, dass mein Social-Media-Konsum nicht zur Sucht wird? «Es geht darum, Methoden und ein Bewusstsein zu entwickeln, um
mit persönlichen Herausforderungen umzugehen», erläutert Jamie Rizzi.
Die Studie: Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre
– Die Befragung verwertete 44 669 Rückmeldungen von Lernenden, die durchschnittlich 17-jährig waren.
– Die Realisierung der Studie wurde durch eine finanzielle Förderung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation, der Gesundheitsförderung Schweiz, der Stiftung ALU, der Stiftung für Hilfe-Leistungen an Arbeitnehmende und der Stiftung Artisana ermöglicht.
– Durchgeführt wurde die Befragung von Work Med, Zentrum Arbeit und psychische Gesundheit, mit Unterstützung von Lernenden und in Kooperation mit den Akteuren in der Berufsbildung, der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Befragungsfirma Valuequest.
– Insgesamt wurden die Befragten in 36 international definierte Berufsgruppen eingeteilt. Zehn Gruppen waren stärker vertreten als der Bereich Gastronomie / Catering mit 2.89 Prozent der Befragten. Die stärksten Gruppen waren mit 14,7 Prozent Sozialarbeit und Beratung, Krankenpflege und Geburtshilfe mit 12,9 Prozent sowie mit 11,6 Prozent Sekretariats- und Büroarbeit. phg.
workmed.ch/wp-content/uploads/bericht-studie-lernende-de.pdf