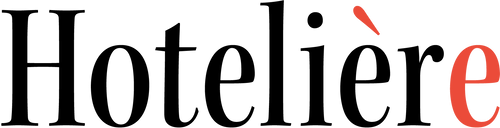«Champagner macht nicht betrunken, sondern glücklich.» Das sagt Marc Rohrbach, Direktor Nicolas Feuillatte Schweiz. Er sagt auch, dass Champagner den Gästen in der Regel zu teuer angeboten wird. 100 Franken oder mehr pro Flasche Brut, bei einem Einstandspreis von ungefähr dreissig Franken, sind für ihn nicht nachvollziehbar. Viele weitere prickelnde, perlende Champagner-Insides lesen Sie im Gespräch mit dem Champagner-Händler, der gerne auch Grünen Veltliner oder Rieslinge aus Österreich oder Deutschland trinkt.
Ist das Champagner-Frühstück noch ein Thema?
Marc Rohrbach: Nein, so gut wie nirgends mehr. Auch nicht in grossen Fünf-Sterne-Häusern. Die Gäste wollen am Morgen keinen Alkohol, das gibt es nur noch in Filmen. Der Lebensstil hat sich geändert, sodass Champagner zum Frühstück nicht nur aus Kostengründen wegfiel. Dort, wo Champagner am Morgen noch angeboten wird, ist er eher Dekoration. Im wirklichen Leben ist dieses Angebot passé – Ausnahmen gibt es aber immer, wenn auch sehr selten.
Und wie steht es mit Champagner im Fine-Dining? Hat Champagner wenigstens da noch einen Hauch von Luxus?
Wine & Dine ist vorbei. Die Gäste wollen heute lieber individuelle Anlässe auf eine persönliche Einladung. Kürzlich haben wir für eine Kitchen-Party in einer Berghütte sieben Köche engagiert und dafür nur siebzig Tickets angeboten. Sofort war der Event ausgebucht, ein Riesenerfolg. Die Leute wollen nicht mehr stundenlang an einem Tisch sitzen. Sie wollen aktiv sein, Kontakt haben. Es muss lebendig sein. Die Afterparty nach Rückfahrt mit der Bergbahn dauerte bis in die Morgenstunden. Nicolas Feuillatte ist eine junge, eine lebendige Marke, die alle Generationen anspricht, vom Studenten bis zum Label-Trinker. Wir wollen keine steifen Sachen.

Welche Trends beobachten Sie im aktuellen Konsumverhalten von Champagner, speziell in der Hotellerie und der Gastronomie?
Gibt es überhaupt noch Trends? Ich möchte die Frage mit «Jein» beantworten. Champagner ist fast ein «langweiliges» Produkt, weil es immer aktuell ist. Einen Trend stelle ich fest, hin zu Chardonnay Blanc de Blanc. Das dürfte damit zusammenhängen, dass alle Blanc de Blanc aussprechen und bestellen können, ohne sich eine Blösse zu geben. Das ist bei einem komplizierten Champagner-Namen nicht immer der Fall. Ein Phänomen ist Rosé. Das Rosé-Bedürfnis wächst konstant. Im Winter wird weniger davon konsumiert, aber im Frühling steigt die Nachfrage verlässlich. Rosé und Blanc de Blanc haben sich neben Brut-Champagner etabliert. Dabei ist der Preisdruck auf den Brut am höchsten, obschon er von der Produktion her der schwierigste ist.
Beobachten Sie Unterschiede im Konsumverhalten in den verschiedenen Regionen der Schweiz?
Wir haben 26 Kantone und man kann sagen, dass es eigentlich 26 verschiedene Champagner-Länder sind. Die Situation ist extrem unterschiedlich. In Zürich bestellen sechs zusammengehörende Personen je ein Glas Champagner. In Lausanne bestellen zwei Personen gemeinsam eine Flasche Champagner. In der Romandie werden zwei Drittel des Champagners getrunken, auf die Deutschschweiz fällt der Rest. Das Tessin wird vom Monte Ceneri geteilt: Locarno, wo viele Deutschschweizer ihre Ferien verbringen oder leben und jeder Deutsch versteht, ist Champagner-Land. Lugano dagegen ist bereits Italien. Man ist chic, pflegt die Italianità und trinkt Franciacorta.
Wo wird in der Schweiz am meisten Champagner getrunken?
Zürich, Basel und Genf sind die Schweizer Champagner-Städte, alle sind international ausgerichtet. Auch in den Walliser, Berner und Bündner Skiorten wird – allerdings nur saisonal – gerne Champagner getrunken.
Gibt es weitere Besonderheiten, die Sie im Champagner-Land Schweiz feststellen?
Sehr interessant finde ich die Preiskonstellation in der Schweiz. Es scheint, dass es zwischen dem Champagner-Verkauf und der jeweiligen gesellschaftlichen Struktur einer Region eine Verbindung gibt. Die drei Champagner-Hauptstädte habe ich genannt. Luzern ist ein Mittelding, während Champagner in Bern kein grosses Thema ist. Für mich als Weinverkäufer ist es sehr wichtig, diese differenzierte schweizerische Champagner-Landschaft zu kennen. So pflege ich mit den regionalen Gastronomie- und Hotelvereinigungen und mit alteingesessenen, treuen Familien, häufig in Landgasthöfen, gute Kontakte. So ist Champagner verkaufen und kaufen ein Geschäft unter Freunden.
Dennoch, der Champagner-Preis spielt sicher eine Rolle?
Ja, aber der Preis ist nicht der entscheidende Verkaufsfaktor, da er zwischen den verschiedenen Anbietern heute fast austauschbar ist. Vor 30 Jahren lag der Einstandspreis pro Flasche für den Offenausschank im Mittel etwa bei 25 Franken. Heute liegt er 4 bis 5 Franken höher, bei 29 oder 30 Franken. Bei diesem Einstandspreis schaut für uns im Schnitt ein sehr geringer Nettoertrag heraus, da wir auch sehr viel in die Hotellerie und Gastronomie investieren, sei dies mit Material für den Champagnerausschank oder für die Verkaufsförderung.
Vom relativ tiefen Einkaufspreis spüren die Gäste aber wenig.
Das Problem ist, dass Champagner heute gegenüber den Gästen zu teuer angeboten wird. Wenn ich Weinkarten anschaue, stelle ich fest, dass eine Flasche Champagner Brut fast immer über 90 oder 100 Franken kostet. Das ist in meinen Augen ein zu hoher Preis. Ich sehe keinen Grund, so hochzugehen. Beim Offenausschank liegt die Sache etwas anders, man könnte wohl besser ein Angebot mit Demi-Flaschen machen. Kleine Champagner-Flaschen sind für uns ein Wachstumsprodukt.
Wenn nicht mehr der Einkaufspreis den Ausschlag gibt, dass ein Hotelier auf Ihr Angebot einschlägt, was ist es dann?
Heute steht die Wirtschaftlichkeit für den Hotelier im Vordergrund. Als Lieferant muss ich mich fragen, wie ich den Hotelier unterstützen kann, dass er möglichst kein totes Kapital im Keller lagert. Da spielen Dienstleistungen wie die Champagner-Lieferung innert 24 Stunden oder der Verzicht auf den Verkauf von ganzen Paletten eine grosse Rolle. Der Käufer soll von uns frische Produkte geliefert bekommen.
Wer sind Ihre Ansprechpartner und Entscheider beim Champagner-Einkauf in einem Hotel?
Es ist nicht primär der F&B-Verantwortliche, ausser man hat einen grossen Sommelier im Haus, der etwas ganz Bestimmtes will. Beim Champagner-Kauf entscheidet meistens die Führungsetage oder zuweilen auch die Inhaber. Das, obwohl der Beitrag des Champagners am gesamten Betriebsertrag eines Hotels nirgends eine entscheidende Grösse ist.
Bieten Sie mit Nicolas Feuillatte auch eine Art Einstiegs-Champagner für den Offenausschank oder allenfalls Haus-Champagner für ein Hotel an, so wie das beispielsweise bei Kaffee der Fall ist?
In der Schweiz gibt es für Nicolas Feuillatte drei zentrale Märkte: den Detailhandel – Coop, Manor, Denner – mit speziellen Produkten, die nur dort erhältlich sind. Damit wird das Verkaufsvolumen gemacht. Der zweite Markt ist die Hotellerie und Gastronomie, wo wir andere Produkte anbieten. Da verkaufen wir hochwertigere Produkte – beispielsweise Brut exklusive, Champagner, der nur für die Hotellerie angeboten wird. Der Markenname steht an beiden Orten und bei allen Nicolas-Feuillatte-Produkten drauf. Dann gibt es noch den Weinfachhandel. Da bieten wir Champagner mit besonderer Verpackung oder in speziellen Flaschen oder zu speziellen Anlässen. Mit einem Augenzwinkern könnte man sagen, sind das Bling-Bling-Produkte.
Welche Rolle spielen spezielle Angebote wie Limited Editions oder Jahrgangs-Champagner in Ihrem Sortiment?
Das ist ein wichtiges Thema. Zu Weihnachten gibt es spezielle Angebote für Grosskunden, um ein Produkt bekannt zu machen. Wir arbeiten auch mit Künstlern zusammen, wie kürzlich mit dem bekannten libanesisch-britischen Sänger und Komponisten Mika. Ein Jahrgangs-Champagner ist übrigens das gleiche Produkt wie ein «normaler» Champagner – ausser, dass natürlich ausschliesslich Trauben aus dem angegebenen Jahrgang darin sind.
Wie beurteilen sie den heutigen Champagner-Markt?
Der Champagner-Markt ist sehr anspruchsvoll, da er durch sehr viele Produkte übersättigt ist. Das hat viel mit unserem Lifestyle zu tun. Früher lief der Champagner-Verkauf fast automatisch. Man konnte nichts falsch machen. Mitte der neunziger Jahre war der Champagner-Markt in der Schweiz weniger komplex. Es gab klare Marken und wenig Konkurrenz. Heute bestimmen der Wettbewerb durch Schaumweine aller Art, die steigenden Kosten, strengere Regulierung und ein verändertes Verhalten der Konsumenten die Branche. In diesem Umfeld sind Differenzierung und Mehrwert die entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine Marke.
Wie sehen Sie die Konkurrenz für den Champagner durch andere Schaumweine?
Kunden, die Champagner trinken wollen, weichen kaum auf Prosecco aus. Die Schwierigkeit ist heute das riesige Schaumwein-Angebot. Bei Coop werden Schaumweine, neu auch Franciacorta oder der lange belächelte deutsche Sekt, gefühlt auf etwa 30 Metern angeboten. Jede Flasche davon ist eine Flasche weniger Champagner. Immerhin hatten die Champagner-Produzenten rechtzeitig reagiert und für ihren Markenschutz erfolgreich lobbyiert. Damit konnten sie eine hochwertige Lebensfreude vor Kopien schützen.
Sehen Sie Chancen für Schweizer Schaumweine?
Wegen der kleinen Mengen sind sie ziemlich teuer im Verhältnis zum Champagner. Beim vorhandenen Grossangebot anderer Schaumweine sind nur relativ wenige Leute bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Die Konkurrenz ist riesig, es werden rund 360 Schaumwein-Marken in die Schweiz importiert. Die Chancen für den Export von hiesigen Schaumweinen sind sehr beschränkt. Da Schweizer Produkte generell teurer sind und Schaumweine besonders lange Entwicklungsphasen haben, für die grosse Investitionen nötig und die Mengen bescheiden sind, sehe ich keine echte Chance. Dennoch gibt es die eine oder andere Produzenten-Nachwuchshoffnung.
Wie differenzieren Sie das Nicolas-Feuillatte-Angebot im Vergleich zu anderen Marken?
Bling-Bling bei besonderen Gelegenheiten ist eine Differenzierungsmöglichkeit. Bei unserem Label macht das einen sehr geringen Teil des Umsatzes aus, aber es muss im Angebot sein. Der Standard-Konsument ist entscheidend für den Erfolg eines Champagners. Er kauft Easy-to-Drink-Champagner, der geschmacklich etwas anders ist als andere Champagner. Das sind jedoch keine Fragen der Qualität, sondern des individuellen Geschmacks. Alle Champagner, die heute gekauft werden können, sind völlig okay. Da Nicolas Feuillatte seit Jahren in Frankreich die Nummer 1 ist – nehmen wir das als Indiz dafür, dass wir den Geschmack der breiten Bevölkerung treffen.
Wann trinken Sie eigentlich Champagner – geplant oder spontan?
Ganz privat, daheim, liebe ich Weissweine – Riesling, Grünen Veltliner aus Österreich oder Deutschland. Ich mag Weisse mit etwas Restsüsse. Champagner trinke ich nach Lust und Laune, ganz ohne Grund. Champagner ist für mich ein wunderbares Getränk – etwas Schönes, Erfrischendes und Leichtes, das dem Augenblick eine besondere Note verleiht und trotzdem easy to drink ist. Wein mit Bubbles. Für mich war Champagner nie ein rares Luxusgut, sondern ein selbstverständlicher Teil des Lebens. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem man Champagner stets als Alltagsgetränk verstand – ein Begleiter, der das Besondere in den Alltag bringt.

Zusammenarbeit mit Hotels und den Service-Mitarbeitenden
Wie arbeiten Sie mit Ihren Hotel-Kunden zusammen? Bieten Sie Schulungen für Sommeliers oder die Service-Mitarbeiter an?
Marc Rohrbach: Schulungen sind wichtig, vor allem bei Frontleuten. Mir ist es wichtig, dass alle im Service tätigen Mitarbeitenden eines Hotels unser Produkt getrunken haben. Die Geschichte einer Champagner-Maison, ihre Herstellung oder die Meinung eines Gastes sind nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Leute im Service den Champagner kennen, den sie verkaufen. Der Service ist das Wichtigste. Dazu mache ich die Schulungen, gelegentlich mit Unterstützung aus unserer französischen Genossenschaft. Zudem bieten wir spezifische Marketingangebote. So stellen wir Gläser oder Flaschenkühler gratis zur Verfügung, wenn es gewünscht ist. Besonders gerne unterstütze ich Personalanlässe, denn die Mitarbeitenden sind für mich im Hotel die massgebenden Leute.
Ist Nachhaltigkeit in der Champagner-Produktion ein Punkt, der bei den Verkaufsgesprächen mit Ihren Hotelkunden angesprochen wird?
In der Champagne ist das ein kleines Thema. Dort nimmt man das Thema Nachhaltigkeit zur Kenntnis und weiss, dass es das gibt. Selbstverständlich haben wir Bio-Champagner im Sortiment – Nicolas Feuillatte Extra Brut Organic. Die Nachfrage nach Bio-Champagner aber ist nahe null. Ich könnte das Produkt ohne Verlust auslisten. Nachhaltig ist Nicolas Feuillatte bei der Verpackung und der Logistik. Wir betreiben keinen Keller, sondern Lagerhallen, die sind ökonomischer und ökologischer zu betreiben. Ob mit oder ohne Nachhaltigkeitsthematik, der Champagner behält seinen Status und die Konsumenten fragen nichts anderes nach. Auch in der Hotellerie war Nachhaltigkeit bei Champagner in meinen Gesprächen nie ein Thema. Ganz anders ist es dagegen im Detailhandel.

Marc Rohrbach über Nicolas Feuillatte
Terroirs & Vignerons de Champagne (TVC) vereint heute die Marken Nicolas Feuillatte, Abelé 1757, Castelnau und Henriot. Mit über 6000 angeschlossenen Winzern und mehr als 3000 Hektar Rebfläche ist TVC die grösste Winzervereinigung der Champagne. Diese einzigartige genossenschaftliche Struktur garantiert Vielfalt, Qualität und Authentizität.
Champagne Nicolas Feuillatte wurde 1976 als Teil der TVC gegründet. Das Haus basiert auf dem Genossenschaftsmodell: über 5000 Winzer aus allen Terroirs der Champagne – von der Côte des Blancs bis zur Montagne de Reims. Das Portfolio reicht von eleganten
Non-Vintage-Cuvées bis hin zur Prestige-Cuvée Palmes d’Or. Mit einem klaren Fokus auf Zugänglichkeit, Innovation und Lifestyle hat sich Nicolas Feuillatte als moderne Ikone etabliert.
Champagne Nicolas Feuillatte ist heute die meistverkaufte Marke in Frankreich. Sie zählt weltweit – und mittlerweile auch in der Schweiz – zu den führenden Champagnerhäusern.