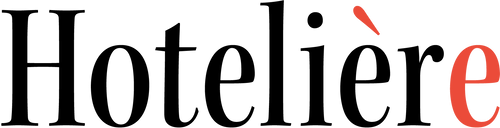Zwei Begriffe, zwei völlig verschiedene Wahrnehmungen: Einkaufstourismus, ein Problem. Shopping-Tourismus, eine Chance. Wurde die Politik beim grenznahen Einkaufstourismus aktiv, erkennt sie die Chancen für den Tourismus und die Hotellerie beim Shopping-Tourismus (noch) nicht. Um im internationalen Shopping-Tourismus erfolgreich zu sein, wären zwei Voraussetzungen zu erfüllen. Die Mindestsumme für Tax-Free-Shopping müsste stark reduziert oder abgeschafft werden. Und für die Rückforderung der Mehrwertsteuer durch Touristen braucht es eine digitale Lösung. Was technisch und wirtschaftspolitisch zu tun ist, zeigen Italien und das weltweit tätige Schweizer Unternehmen Global Blue. Hilmar Gernet
Gegen den Einkaufstourismus im grenznahen Ausland wehren sich vorab Grenzkantone und der Schweizer Detailhandel.Auf Gesetzesebene waren sie erfolgreich. Seit Anfang des Jahres dürfen nur noch Waren im Wert von 150 Franken –statt 300 Franken – ohne Mehrwertsteuer (MwSt.)eingeführt werden. Verändert habe die neue Zollregelung nicht viel, zitiert die «NZZ» (Der Aufstand der Preisrebellen, 3.5.2025) einen überzeugten Einkaufstouristen. Er sieht das Einkaufen im Ausland als «Akt des Widerstandes» gegen die Hochpreisinsel Schweiz. Der Einkaufstourismus habe sich «auf hohem Niveau stabilisiert», meint ein Grossverteiler im«NZZ»-Artikel. Der Branchenverband der Detailhändler schätzt, dass jährlich 8,5 Mrd. Franken ins grenznahe Ausland fliessen. Für die Verbandsdirektorin ist es nur eine Frage der Zeit, bis wegen der Einkaufstouristen die «Löhne und Arbeitsstellen in der Schweiz betroffen sind». Ob wahr oder falsch? Wir machen hier einen harten Schnitt.
Modell Italien
Reden wir vom zweiten Phänomen, dem Shopping-Tourismus. Viele Feriendestinationen rund um den Globus schreiben dazu eine Erfolgsgeschichte. Italien beispielsweise hat 2024 die Mindesteinkaufsumme für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer von 155 auf 70 Euro gesenkt. Kleine Massnahme, grosse Wirkung. Eine Studie des Schweizer Payment-Unternehmens Global Blue (2024) zeigt für Italien, wie sich diese Senkung positiv auf die Einkäufe im Preissegment unter 155 Euro in mittelgrossen Städten auswirkte. Die Umsätze stiegen vor allem in den mittelgrossen Städten: Como +66 Prozent, Catania +65, San Gimignano +62, Neapel und Amalfi je +61, Verona und Assisi je +57, Bologna +47. Bei den vier Top-Shopping-Städten Mailand, Rom, Florenz und Venedig reduzierte sich hingegen der Anteil der touristischen Einkäufe von zuvor 75 Prozent, als die Einkaufssumme bei über 155 Euro lag, auf 51 Prozent für Einkäufe zwischen 70 und 155 Euro.
Die Global-Blue-Studie kommentiert diesen Effekt für die mittelgrossen Tourismus-Städte als «positiven Dezentralisierungseffekt für den Tourismus». Es profitierten also nicht nur die Hotspots, die teils eh schon unter Overtourism leiden. Insgesamt habe die Senkung der Tax-Free-Mindesteinkaufsumme für ausländische Touristen vielmehr einen «positiven Einfluss auf die Gesamtwirtschaft», schreibt GlobalBlue. Tatsächlich führte das Volumen des Tax-Free-Shoppings in Italien 2024, nach der halbierten Tax-Free-Einkaufssumme, zu einem Umsatzanstieg von 4 % bei den Einkäufen zwischen 70 und 155 Euro im Vergleich zum Referenzjahr 2019 (Vor-Covid-Jahr =100 Prozent). Die Transaktionen für Mehrwertsteuer-Rückforderungen aufgrund von Einkäufen bis 155 Euro sind sogar um 40 Prozent gestiegen.
Chance für die Schweiz
Die Bergwelten, die Seenlandschaften, der öffentliche Verkehr, viele Sehenswürdigkeiten und die guten Einkaufsmöglichkeiten würden die Schweiz prädestinieren, das italienische Modell des Shopping-Tourismus zu adaptieren. Viel bräuchte es dazu nicht. Die Änderung einer Verordnung, welche die Rückforderung der schweizerischen Mehrwertsteuer ab 150 Franken (heute 300) für Produkte erlaubt, die hier von ausländischen Touristinnen und Touristengekauft wurden. Und ein digitales Tool, das die einfache, schnelle MwSt.-Rückforderung für heimkehrende Touristen an den Grenzen, Flughäfen oder Bahnhöfen möglich macht. Die rechtliche Anpassung wäre in gewissem Sinne das Pendant zum mehrwertsteuerfreien Import der Billig-Einkäufe bis 150 Franken pro Person der Einkaufstouristen jenseits derGrenze.
Bisher hat die Schweiz die höchste Mindesteinkaufsummein ganz Europa: umgerechnet 305 Euro, mit grossem Abstand auf Ungarn mit dem zweithöchstenMinimalbetrag (174 Euro) und Belgien (125 Euro).Weshalbhat dieses Handelshemmnis niemand aufdem Radar? Tatsächlich reichte ein Blick nach Europa,wo der Trend schon lange in Richtung Senkung odergar gegen null geht. In Spanien gibt es keine Limitemehr, keinen Mindesteinkauf für Tax-Free-Shopping,dass Touristen die Mehrwertsteuer zurückfordernkönnen. Deutschland will diesen Sommer nachziehen.Es wird ebenfalls auf eine Mindestsumme für densteuerfreien Einkauf verzichtet (bisher 50 Euro).In den anderen Nachbarländern liegen die Tax-Free-Einkaufssummen wesentlich tiefer als hierzulande:Italien 70 Euro (seit 2024, vorher 155 Euro), Österreich75 Euro, Frankreich 100 Euro. Die durchschnittlicheTax-Free-Einkaufsumme in der EU liegt bei 36 Euro(höchste: Ungarn 174 Euro, tiefste: Spanien 0, Schweden17, Norwegen 27).
Booster für Hotellerie und Gastronomie
Den Ländern, welche die Mindesteinkaufsumme senken, winken vor allem volkswirtschaftliche Chancen. Tax-Free-Shopping schafft einen breiteren Zugang zu Tourismusmärkten, der gerne mit Luxusartikeln wie Uhren, Schmuck, Kosmetik sowie Mode teurer Labels in Verbindung gebracht wird. Neu können auch KMU, Gewerbe und lokal-regionale Händler mit ihren Produkten am Tourismus-Shopping-Markt teilnehmen und so einen Mehrumsatz erzielen. Ihre qualitativ guten Produkte, die in vielen Fällen in tieferen und mittleren Preissegmenten angesiedelt sind (z. B. Souvenirs,Schweizer Kosmetika und Modeartikel, Sackmesser, Kunsthandwerk, Lebensmittel-Spezialitäten), sind für Shopping-Touristen attraktiv. Nicht zuletzt auch, weil sie handlich sind. Die Mehrwertsteuer-Rückerstattung bereits für eine kleinere Einkaufssumme wird so zum Booster für die regionale KMU-Wirtschaft: Es können grössere Umsätze und bessere Einkommen erwirtschaftet und somit im Detailhandel, in Hotellerie und Gastronomie neue Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende gesichert werden.

Shopping-Tourismus ist weltweit wachsend. Die Möglichkeit zu shoppen, ist für viele Touristen zu einem entscheidenden Motiv für die Wahl ihrer Reise- und Feriendestination geworden. Vor allem Reisende aus Nicht-EU-Ländern, den USA, den Golfstaaten oder Asien – in der Regel mit gut dotierten Reisebudgets – geben drei bis vier Mal mehr aus als lokale Kunden bzw. einheimische Touristen. Shoppen ist ein touristisches Erlebnis. Und Shopping-Tourismus ist nicht abhängig vom Wetter oder den Jahreszeiten. Er findet das ganze Jahr statt.
Mit einer wahrnehmbaren Marktpositionierung als Shopping-Destination könnte sich die Schweiz auf der touristischen Weltkarte zusätzliche Beachtung verschaffen, ist Matthias Malär, Managing Director von Global Blue Schweiz, überzeugt. Davon profitierten auch Hotellerie und Gastronomie, denn Shopping-Touristen buchen auch Übernachtungen. Dies nicht nur in den heutigen touristischen Hotspots wie Zürich, Genf, Luzern, Interlaken oder Zermatt. Was also hält die Schweiz zurück, die Rahmenbedingungen für Shopping-Tourismus zu verbessern?
Auswirkungen auf die Bundeskasse
Ist des Shopping-Touristen Freud ein Leid für die Bundeskasse? Eine wichtige Frage in diesen Zeiten. Das Parlament debattiert in der kommenden Wintersession darüber, ob und wie die Bundeskasse 2027 um rund 2,7 Mrd. Franken und 2028 um rund 3,6 Mrd. Franken nicht durch Sparen gesunden soll, sondern durch das «Entlastungspaket 2027». HotellerieSuisse begrüsst in ihrer Medienmitteilung zum Entlastungspaket die Bemühungen, «die Staatsausgaben im Griff zu behalten». Um dann aber festzustellen, dass der Tourismus «durch die Einsparungen im Entlastungspaket überproportional belastet» werde. Bei SchweizTourismus sei eine Kürzung von 20 Prozent vorgesehen. Dies hätte direkte Auswirkungen auf die internationale Vermarktung der Schweiz und deren langfristige Positionierung als nachhaltiges Reiseland.
Während die Politik bald um «Entlastungen» für den Bundeshaushalt in Milliardenhöhe streiten wird, sieht Matthias Malär, Managing Director Global BlueSchweiz, die Reduktion der Mindesteinkaufsumme auch im aktuellen Finanzkontext entspannt. Er rechnetbei einer Halbierung der gegenwärtigen Tax-Free-Mindestkaufsumme auf 150 Franken mit Mindereinnahmen für den Bund von rund 2 bis 2,4 Mio. Franken. Dem stellt er einen konservativ gerechneten Multiplikationsfaktor von 1,6 bis 1,8 an positiven volkswirtschaftlichen Effekten gegenüber (Mehrumsatz/geschätzt rund 35 Mio. Franken, Hotelübernachtungen, Gastronomie, Arbeitsplätze).
Kompensation für die «Hochpreisinsel»
Wesentlich ist für Matthias Malär der Attraktivitätsgewinn für die Tourismus-Destination Schweiz. «Es wird eine Schlechterstellung der Schweiz im internationalen Tourismus und vor allem im Shopping-Tourismus verhindert», sagt Malär. In der Reduktion der Mindesteinkaufsumme für die Mehrwertsteuer-Rückforderung für den Shopping-Tourismus sieht Malär ein kompensierendes Mittel gegen die «natürlichen Wettbewerbsnachteile der Hochpreisinsel Schweiz mit ihrem starken, teuren Franken». Er ist überzeugt, dass damit neue Marktchancen für die Hotellerie, die Gastronomie, den lokalen und regionalen Handel und KMU geschaffen werden. «Shopping-Tourismus hat für die Schweiz keine negativen Effekte.»
e-Validierung ist zwingend
Es bleibt nochmals die Frage, was hindert die Schweiz, Shopping-Tourismus hierzulande wirklich zum Fliegen zu bringen? Die Antwort von Matthias Malär kommt wie aus der Pistole geschossen. «Zwingend ist eine digitale Lösung, eine e-Validierung. Ohne geht es nicht.»
Heute läuft bei der Mehrwertsteuer-Rückforderung noch alles in manuellen Prozessen. Im Verkaufsladen ist ein Papierkrieg nötig: Das Rückerstattungsformular wird zwar im IT-System ausgefüllt, dann aber ausgedruckt und vom Käufer und Verkäufer unterschrieben. Der Shopping-Tourist muss danach zur Zollstelle gehen und sich dort einen Stempel holen, um zu seinem Geld zu kommen. Hat er dafür keine Zeit, so bleibt ihm die Möglichkeit, den Stempel auf der Schweizer Botschaft in seinem Heimatland zurückzufordern. Das ist alles kompliziert und aufwändig. Mancher wird sich daher sagen, der Aufwand lohne sich nicht, vor allem bei kleinen Rückerstattungen. Für die Shopping-Touristen – und auch die schmalen Ressourcen beim Grenzpersonal – muss eine einfache, komfortable, digitale Abwicklung der Mehrwertsteuer-Rückerstattungsangeboten werden können.
Der Politik ist schon seit längerem klar, dass die Papierbürokratie an der Grenze dereinst der Vergangenheit angehören sollte. Nur in diesem Fall mahlen die Mühlen in Bern sehr langsam: Seit dem ersten entsprechenden parlamentarischen Vorstoss 2017 für gesetzliche Anpassungen sind Jahre ins Land gezogen. In Europa haben heute einzig die Schweiz und Deutschland noch keine durchgängig digitalen Prozesse beziehungsweise Software-Lösungen, welche die spezialisierten Payment-Unternehmen quasi zumSelbstkostenpreis anbieten. Diese Software wäre, ohne teure staatliche Eigenentwicklungen, mittels Schnittstellen für alle Systeme der Händler kompatibel.
Noch fehlt die politische Priorität
«Die digitalen Tools», so Global Blue Schweiz Managing Director Malär, «wären parat. Business-to-Business funktioniert, Business-to-Client aber noch nicht.» Er sieht grundsätzlich die Vorgaben für eine Digitalisierung aller Zollprozesse als gewährleistet an. «Von der Regulierung her wäre eine e-Validierung möglich»,führt er aus. Dann kommt ein Aber: «Aber politisch hat das e-Validierungsmodell noch keine Priorität.»
Der Schweizer Matthias Malär will jedoch dranbleiben und die längst gängigen, global weit verbreiteten digitalen Prozesse mit einer Industriesoftware auch in seiner Heimat etablieren. Obschon Unternehmenwie Global Blue, die auf eine Mehrwertsteuer-Rückerstattung spezialisiert sind, nur indirekt profitieren. Dann nämlich, wenn durch eine einfache Abwicklung für Touristen und bestenfalls die Senkung der Mindesteinkaufsumme die Verkäufe an Touristen in der Schweiz zunehmen und Steuersubstrat generieren, das sonst im (benachbarten) Ausland erwirtschaftet würde.