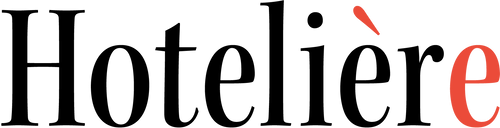Mitarbeitende arbeiten nicht selten mehr als die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit. Arbeitgeberseitig besteht die Pflicht, die Arbeitszeiten und damit auch die Überstunden aufzuzeichnen. Wenn keine Arbeitszeiterfassung gemacht wird, kommt die Diskussion auf, wie die effektiven Arbeitszeiten ermittelt werden und bei wem die Beweislast dafür liegt, ob Überstunden geleistet wurden oder nicht.
Martin Schwegler
Das schweizerische Zivilprozessrecht ist vom Grundsatz geleitet, dass wer das Bestehen von Ansprüchen behauptet, dies beweisen muss. Konkret lautet Art. 8 ZGB: «Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.» Das Bundesgericht musste sich nun kürzlich mit der Frage befassen, ob diese Regel im Gastgewerbe auch gilt. Denn in Art. 21 Ziff. 4 L-GAV steht: «Kommt der Arbeitgeber seiner Buchführungspflicht nicht nach, wird eine Arbeitszeiterfassung oder eine Arbeitszeitkontrolle des Mitarbeiters im Streitfall als Beweismittel zugelassen.» Das Bundesgericht stellte in seinem französisch verfassten Entscheid erneut fest, dass diese Klausel im L-GAV nicht zu einer sogenannten Beweislastumkehr führt (BGer 4A_59/2024). Denn dies behauptete der Beschwerdeführer. Leider kann man den genauen Sachverhalt nicht aus dem Entscheid entnehmen. Tatsache war, dass der Arbeitgeber keine Zeiterfassung führte und dann der Mitarbeiter offenbar eine gewisse Menge an Überstunden behauptete, ohne diese offenbar genügend darzulegen.
Mitarbeitende müssen Überstunden glaubhaft machen
Das Ergebnis ist jedoch klar: Auch wenn der Arbeitgeber keine Zeiterfassung führt, muss ein klagender Arbeitnehmer die behaupteten Überstunden zumindest glaubhaft machen. Das gelingt im Regelfall nur mit einer eigenen Zeiterfassung. Wenn beispielsweise eine Art Tagebuch geführt wird – also in einer Agenda jeweils fortlaufend, wahrheitsgetreu und handschriftlich festgehalten wird, wann Arbeitsbeginn und -ende war, sowie wann Pausen gemacht werden konnten und eventuell noch Bemerkungen gemacht werden, weshalb man länger arbeiten musste –, hat ein Arbeitgeber vor Arbeitsgericht ohne eigene Zeiterfassung keine Chance. Sobald aber nur die Anzahl gearbeitete Stunden aufgeschrieben werden und die Aufzeichnungen nur in einer Excel-Datei erfolgen, dann wird es schon schwieriger: Je ungenauer die Aufzeichnungen, umso besser können sie angezweifelt werden. Das Vertrauen in digitale Dateien ist nicht sonderlich hoch, weil diese ja jederzeit abgeändert werden könnten.
Pausen müssen genau erfasst werden
All jene Betriebe, die, wie vom Art. 21 L-GAV gefordert, die Arbeitszeiten sauber und nach den Vorgaben des Arbeitsgesetzes erfassen, haben keine Probleme. Die Mitarbeitenden haben diese ja unterzeichnet und damit als richtig anerkannt. Eine allfällige abweichende eigene Zeiterfassung wäre faktisch wertlos. Denn stimmt die Arbeitszeiterfassung des Arbeitgebers nicht, darf man sie nicht unterzeichnen.
Allerdings beobachtet man immer wieder, dass Betriebe jeweils die Essenspausen einfach pauschal mit 30 Minuten oder einer Stunde von der Arbeitszeit abziehen. Eine Zeiterfassung, in der immer von 12 bis 12.30 Uhr Pause eingetragen ist, wirkt nicht sehr glaubwürdig. Zudem besteht nach Art. 73 Abs. 1 Bst. e ArG V1 die Pflicht, Pausen von einer halben Stunde und mehr nach ihrer Länge und Dauer zu erfassen. Solche «Standardeinträge» verstossen deshalb gegen diese exakte Aufzeichnungspflicht.
Macht eine Arbeitnehmerin geltend, sie hätte nie exakt an diesen Zeiten Pausen gemacht, sondern situativ nach Lage und Anzahl Gästen, dann wird es kritisch: Nach Art. 15 Ziff. 2 L-GAV gilt die Essenszeit als Arbeitszeit, wenn sich Mitarbeitende während dieser zur Verfügung halten mussten. Der pauschale Abzug oder ein immer gleicher Pauseneintrag sind nachgerade ein Hinweis darauf, dass sich Mitarbeitende während der Pausen zur Verfügung halten mussten. Will man alles korrekt machen und keine prozessualen Risiken auf sich nehmen, bleibt nichts anderes als die Weisung an die Mitarbeitenden, jede grössere Pause zu stempeln. Nur so ist man sicher, dass alle Pausen von 30 Minuten und mehr erfasst sind.
Lohnhöhe ist für Zeiterfassung irrelevant
Nach Art. 15 Ziff. 7 L-GAV darf man mit Mitarbeitenden, die einen Monatslohn von CHF 6750 haben, schriftlich vereinbaren, dass keine Überstundenentschädigung bezahlt werden muss bzw. diese im Lohn inbegriffen ist. Daraus schliessen nun einige Arbeitgebende fälschlicherweise, dass Kadermitarbeitende mit entsprechendem Lohn ihre Arbeitszeiten nicht erfassen müssten. Dem ist nicht so. Zwar sieht die Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz vor, dass ganz auf die Arbeitszeiterfassung verzichtet werden kann (Art. 73a ArG V1), aber nur dann, wenn das Bruttojahreseinkommen CHF 120 000 überschreitet und wenn die Sozialpartner dies so im GAV vorsehen. Das ist in unserer Branche nicht der Fall. Auch die Option einer vereinfachten Zeiterfassung, die nach Art. 73b ArG V1 besteht, bedingt die Mitwirkung der Arbeitnehmervertretung. Auch von diesem Instrument wird meines Wissens in der Branche nicht Gebrauch gemacht. Deshalb gilt die eiserne Regel: Alle dem L-GAV unterstellten Mitarbeitenden müssen ihre Zeiten genau erfassen. Tut dies der Arbeitgeber nicht, der Mitarbeiter aber schon, kann es vor dem Arbeitsgericht teuer werden. 
Martin Schwegler, lic. iur. / RA
Der Autor dieses Beitrags ist seit 1994 Dozent für Arbeitsrecht an der SHL Schweizerischen Hotelfachschule Luzern. Hauptberuflich ist er in der von ihm gegründeten Anwaltskanzlei Schwegler & Partner Anwälte und Notare AG in Menznau (LU) tätig. 2020 hat er die correct.ch ag gegründet, die arbeitsrechtliche Dienstleistungen für die Hotel- und Gastrobranche anbietet. Ein Produkt der Firma ist correctTime, eine Zeiterfassung, die nach L-GAV und ArG korrekt rechnet.