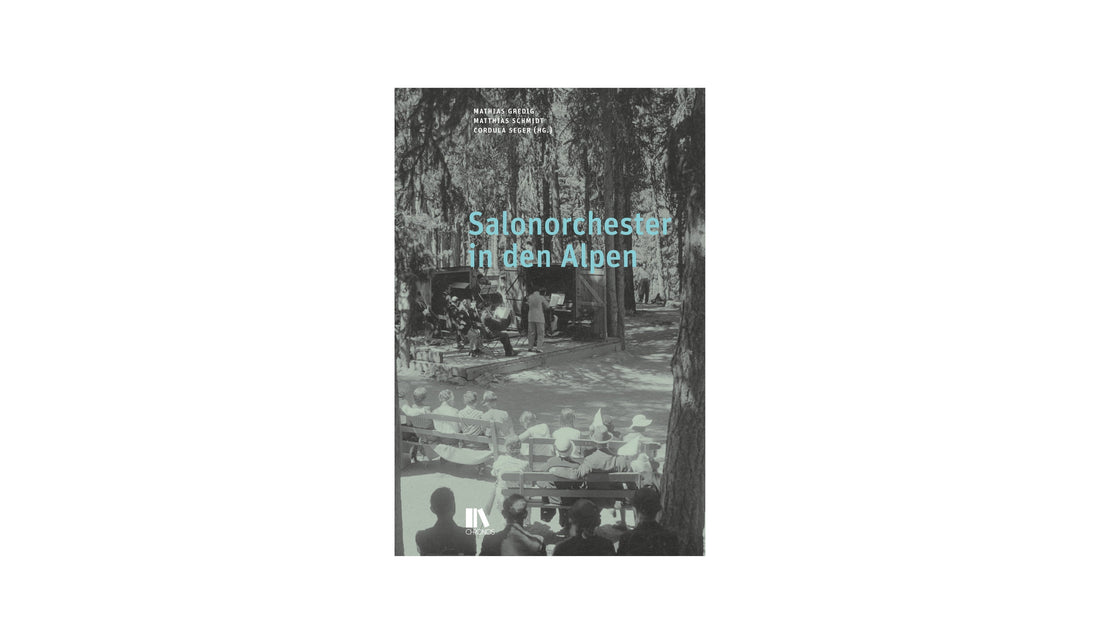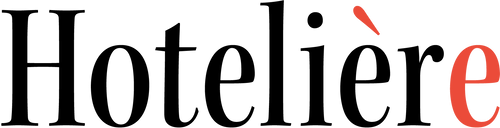Kurgäste und Kur- oder Salonorchester gehörten von 1860 bis in die 1970er-Jahre
zum Standard-Sommerangebot in den Alpen. Die Orchester waren Teil der touristischen Hochkultur. Heute sind sie eine geschätzte Rarität. Dass sie Gegenstand der Kulturforschung geworden sind, ist als Krisenphänomen zu deuten. Das Buch «Salonorchester in den Alpen» widmet sich dem Unbekannten über Salonmusiker, ihr karges Leben und das musikalische Marketingmanagement von Hotels.
Das Forschungsfeld «Salonorchester und Hotellerie» ist weitgehend unbekannt. Das neue Buch «Salonorchester in den Alpen», das 2024 von Mathias Gredig, Matthias Schmidt und Cordula Seger herausgegeben wurde, präsentiert zahlreiche Aspekte zur Geschichte der Salonorchester, aber auch amüsante Geschichten, wie die Liaison eines Kurarztes mit einem «Zürifräulein», die in bedeutenden Memoiren Niederschlag fand. Der Sammelband umfasst 14 gut lesbare und portionierte Beiträge. Eine empfehlenswerte, abwechslungsreiche, lohnende (nicht bloss) Sommerlektüre. Sie bietet Hotel-, Tourismus-, Musik- und Kulturinteressierten neue Einblicke in die Welt der Salonmusiker und -musikerinnen und in ihre nicht selten schwierigen Berufsumstände. Aufschlussreich sind zudem die Überlegungen der Hotels, die Salonorchester als Marketingattraktivität verpflichteten und nutzten. Musikinteressierte kommen voll auf ihre Kosten, wenn saisonale Musikprogramme oder Arrangements der Salonorchester analysiert werden. Ebenso, wenn aufgezeigt wird, wie es mit musikalischen «Tricks» gelang, den Zauber einer ganzen Oper in Dramaturgie und Klangfarbe mit stark reduzierter Instrumentierung zu bewahren.
Kleines Ensemble, grosse Flexibilität
Definiert wird ein «Salonorchester» als «kleines Musikensemble», das in einen Salonraum passt. Im Kern gehören dazu drei Instrumente: Violine, Cello und Klavier/Harmonium – gelegentlich erweitert um weitere Streich-, Blas- und Perkussionsinstrumente. In der Hotelwirklichkeit zeigten sich die Salonorchester äusserst flexibel und spielten nicht nur im Salon, sondern draussen, wenn es verlangt wurde. Ihre Bühne waren auch Eisfelder, sie begleiteten Trink- und andere Kuren, spielten beim Frühstück, beim Lunch, zum Tee, zur Soirée oder zum Tanz. Mit anderen Worten: Sie traten «vom Morgen bis spät in die Nacht in allen möglichen Funktionen» auf.
«Exotismus»
Engagiert wurden die Salon- und Kurorchester in der Alpenregion von «allen grösseren Kurvereinen und Hotels». Sie waren (und sind es auch heute noch) eine Attraktion. Allerdings war es schon damals nicht allein mit Musik und einem sehr breiten Repertoire getan. Vor allem die Gäste, die mehrere Wochen in Kur waren, verlangten nach Abwechslung. Im Buch widmet sich ein Artikel speziell diesem «Exotismus». Dazu gehörten exotische Kulissen im Hotel. Es wurden musikalische Traumreisen nach China, Indien oder Ägypten unternommen, was die «singende Mumie des Tutanchamun» inspirierte. Und selbstverständlich waren Bälle oder Tanzwettbewerbe von den Salonorchestern musikalisch zu gestalten.
Workation
Viele Salonmusiker praktizierten eine Art «Workation», bevor der zunehmende Trend seinen neudeutschen Begriff fand. Sie verbanden Musikarbeit und Sommeraufenthalt in den Bergen miteinander. So bot beispielsweise die «Pianistin Fräulein L. Schubert» dem Kurhaus Val Sinestra 1925 ein Trio für die Zeit von Mitte bis Ende August an, das täglich Konzerte gegen «kostenlose Pension» spielte. In einem Protokoll des zuständigen Verwaltungsratsausschusses heisst es kurz und knapp: «Wird acceptiert.»
32-Stunden-Woche im dunklen Anzug
Den Protokollen des Kurhauses Val Sinestra verdanken wir auch die Information, wie viel 1954 für «Unterhaltung» bezahlt wurde. Das Salonorchester variierte zwischen Duo und Trio (Klavier, Schlagzeug, Gitarre und Gesang). Der Tageslohn lag für den Orchesterleiter (Pianist) bei 20 Franken und für die Sängerin bei 18 Franken. Zum Vergleich: Der Chefkoch im Val Sinestra verdiente das Doppelte und die «Saaltochter» erhielt 1 Franken pro Tag. In einem erhaltenen Arbeitsvertrag für einen Musiker aus dem Jahr 1962 sind eine wöchentliche Arbeitszeit von 32 Stunden und eine Tagesgage von 35 Franken festgelegt. Hinzu kamen freie Kost und Logis bei «Consumation nach Usus des Hauses».
Den Musikern waren auch die Garderobe und das Verhalten vorgeschrieben: «dunkler Anzug, dunkle Schuhe, weisses Hemd, nachmittags und abends (...) kein Rauchen während der Dienstzeit». Zwei Jahre später wurde der «Budgetposten Orchester halbiert». Das Saison-Salonorchester im Kurhaus Val Sinestra wurde 1971 definitiv aufgelöst. An seiner Stelle teilten sich dann drei «Alleinunterhalter» die Saison. Betrügereien eines Musikers, Naturereignisse (Lawinen, Überschwemmungen) und ein Konkurs führten schliesslich 1972 dazu, dass die Tradition der residierenden Musikerinnen und Musiker im Kurhaus Val Sinestra ihr definitives Ende fand.
Internationale Kulturforschung
Verschwunden ist das «schillernde und vielschichtige Phänomen» der Salon- und Kurorchester glücklicherweise (noch) nicht. In Pontresina und St. Moritz beispielsweise lebt die Salon- und Kurorchester-Tradition weiter. Sie inspirierte 2022 auch die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Buches, erschienen im Chronos Verlag, während der internationalen Tagung «SalonOrchester in den Alpen». Den wissenschaftlichen Austausch im Engadin hatten das Institut für Kulturforschung Graubünden und die Universität Basel organisiert. Er bildete die Grundlage für den lesenswerten, aussergewöhnlichen Buch-Exotismus.