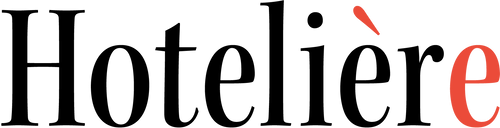Eine etwas andere Presseschau
Regensburg: Wirtshaus-Zukunft nur noch im Museum?
Museen und Ausstellungen entstehen, wenn man sich an die Spitze einer Sache stellen will. So beispielsweise das ZKM – das Zentrum für Kunst und Medien – in Karlsruhe. Es wurde 1989 mit der Mission gegründet, «die klassischen Künste ins digitale Zeitalter fortzuschreiben». Dazu gehört, dass die Sammlungs-, Ausstellungs- und Forschungstätigkeit des ZKM von allerlei Plattformen theoretischer Diskurse zwischen Philosophie, Wissenschaft, Kunst, Politik und Wirtschaft begleitet wird.
Die andere Motivation, eine Ausstellung zu veranstalten, ist, wenn es um eine Sache schlecht steht. Sozusagen als Überlebenshilfe oder bereits als Erinnerung an eine aussterbende, eine totgesagte Einrichtung eröffnete das Regensburger Museum kürzlich die Ausstellung: «Wirtshaussterben? Wirtshausleben!» Die digitale Gesellschaft scheint für den «Hort der Geselligkeit» lebensbedrohlich zu sein. Wohin gehen künftig die Jasser? Wo werden die lokalen Gerüchte produziert und umgeschlagen? Wie werden die politischen Stammtischdebatten mit ihren einfachen Rezepten für die Gemeindepolitik ersetzt?
Die Ausstellungsmacher konstatieren für die Zukunft des Wirtshauses – zumindest in Bayern – die schlechtesten Perspektiven. Sie erwarten eine «Erosion wie bei Kirchen und Parteien». Als Rettungsidee wird – typisch deutsch, ist man versucht zu sagen – vorgeschlagen: «Wirtshäuser sollen vom Staat wie Kulturgüter behandelt werden.» Da bleibt nur die bewährte Stammtischmethode: «Schwoamas owe» (spülen wir es hinunter), wie man in Bayern sagt. (vgl. FAZ, 29.4.2022).
Guide Michelin: «Zeitenwende» am Herd
Es mag etwas frivol erscheinen, den vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz geprägten Begriff der «Zeitenwende» mit den jüngsten Entwicklungen in der Hierarchie deutscher Spitzenköche zu assoziieren. Während Scholz mit der «Zeitenwende» den Überfall Russlands auf die Ukraine markiert, zeigt sie sich im kulinarischen Olymp Deutschlands durch gegenläufige Entwicklungen. Der «Doyen unter den deutschen Spitzenköchen» verliert nach 17 Jahren seinen dritten Michelin-Stern. Der Chefredaktor des «Guide Michelin Deutschland» begründet den «Paukenschlag», die «Herabstufung»: Der Spitzenkoch Joachim Wissler «habe die Geradlinigkeit in seiner Küche verloren, seine Aromenkompositionen seien immer unverständlicher geworden, er habe sich verzettelt».
Ein «kulinarisches Wunder» ereignete sich dagegen offenbar bei Thomas Schanz, der erstmals den dritten Michelin-Stern erhielt. Der kocht «still und leise vor sich hin», «tritt in keiner Fernsehsendung auf», «schreibt keine Bücher», denn «nichts anderes will er, als an seinem Herd stehen». Seinen Aufstieg in den Olymp sei gelungen, weil «er sich keine regionalistischen Fesseln» anlegt, weil er sich «nicht in der Rolle des kochenden Lokalpatrioten» gefällt, weil er auch «kein avantgardistischer Küchenartist ist, der seine Gäste vor Aromenrätsel stellt».
Der stärkste Trend, das Merkmal einer Zeitenwende, es bewahrheitet sich einmal mehr, ist der Gegentrend. So sichert sich das Michelin-Sterne-Ritual als Perpetuum mobile seine mediale Präsenz von Zeitenwende zu Zeitenwende, gelegentlich auch abgelöst durch Wendezeiten. (vgl. FAZ, 10.3.2022).
Haiti: Hotel-Name – nomen est omen
Reisejournalisten in diesen Zeiten sind nicht (nur) zu beneiden. Uns Daheimgebliebenen wollen oder müssen sie die Eindrücke ihrer Reisen so präsentieren, dass wir nicht gänzlich abgeschreckt werden, allenfalls selbst an den präsentierten Ort zu reisen. Haiti oder Transnistrien als Reisedestinationen für Nicht-Politiker stellen für die Schreiber eine besondere Herausforderung dar.
Haiti ist auf eigentlich jeder Statistik am Ende platziert. Port-au-Prince führt einzig die Rangliste der Entführungen und Ermordungen an. Die Stadt werde von «Dieben und Mördern regiert», ist auf eine Mauer gesprayt. Wer mit dem Flieger auf Toussaint Louverture ankommt, wird mit einer gepanzerten Limousine zum Hotel fahren müssen. Beim Aussteigen aus dem Kreuzfahrtschiff in Labadee werden die Passagiere durch «meterhohen Maschendrahtzaun vor Kontakten mit Einheimischen geschützt». Doch nicht genug der grusligen Umstände beim Empfang in einem Land, das eigentlich das Potenzial zu einem Garten Eden hat. Statt von einem Hotel Paradies berichtet der Journalist von seinem Aufenthalt im real existierenden Hotel Massacre in der Stadt Dajabon. Nomen est omen. (vgl. FAZ, 22.4.22).
Transnistrien: Restaurant der Ironie
Der Reisebericht aus Transnistrien, einem Landstrich zwischen der Republik Moldau und der Ukraine gelegen, der in westlichen Medien als «Mafiahochburg», «Schmugglerparadies», «schwarzes Loch am Rande Europas» oder «postsowjetisches Disneyland» beschrieben wird. Transnistrien hat sich 1992 mit militärischer Hilfe aus Moskau in einem «Unabhängigkeitskrieg» von Moldau losgesagt.
Beherrscht wird der von Russland unterstützte Pseudostaat vom Sheriff-Konzern. Das mächtige Firmenkonglomerat ging aus sowjetischen Geheimdienststrukturen hervor, «mit denen es bis heute engstens verbunden ist». Aufmerksam geworden auf Transnistrien sind zumindest Fussballfans. In der Champions League schlug der mehrfache moldauische Meister, die Firmenmannschaft FC Sheriff Tiraspol, in Madrid, im Bernabéu-Stadion, den Heimclub Real Madrid mit 2:1 Toren (28.9.21). Beim Rückspiel gab es für den FC Sheriff Tiraspol dann die standesgemässe Niederlage 3:0 (24.11.21). Doch zurück zum Thema.
Transnistrien ist dank dem Geld des Konzerns ein recht gut funktionierender Sheriff-«Staat». Das Geschäft mit Russland will sich der Sheriff-Besitzer, inzwischen Milliardär, nicht verderben lassen. Aber ein Teil von Russland will man auch nicht werden, sondern bleibt lieber «exterritoriale Filiale des Kremls». Der ehemalige transnistrische «Aussenminister», Wladimir Jastrebtschak, erläutert dem Journalisten die komplexe Situation seines Landes bei einem Kaffee. Und dies in einem Restaurant, dessen Name nur noch ironisch zu verstehen sei: «Zurück in der UdSSR.» Um die Ironie zu bekräftigen, meinte der Aussenminister a. D., er definiere sich klar als Transnistrier. Der Journalist bezweifelt, «ob diese Weltsicht zukunftsfähig ist».
Pontresina / St. Moritz: Eine Frage des Standpunkts
Was wichtig ist, was einem ins Auge springt, ist immer eine Frage des Standpunkts. Das gilt selbstredend für alles Optische. Im übertragenen Sinne trifft dies jedoch auf viele Lebensbereiche zu: Alles scheint im Auge des Betrachters zu liegen. Und, was ich nicht weiss, das macht mich nicht heiss. In der Kommunikation kennen wir die Anforderung, dass es entscheidend ist, wie eine Botschaft beim Adressaten ankommt. Idealerweise ist es die Botschaft, die der Absender zu vermitteln beabsichtigte. Das Anglerlatein bringt dieses Prinzip auf den Punkt: Der Wurm muss dem Fisch, nicht dem Fischer schmecken.
Zur Frage der Betrachtungsweise sah ich kürzlich im Ausland eine Postkarte: «Grüsse aus Pontresina. Die ruhige Rückseite von St. Moritz.» Selbstverständlich ergibt sich auch diese Beschreibung aus dem Blickwinkel des Betrachters. Ob sie richtig oder falsch ist, soll und muss hier nicht entschieden werden. Auf jeden Fall wurde Pontresina als «Hochgenuss» qualifiziert – sommers wie winters. Und wenn wir das grössere Ganze betrachten, so ist doch entscheidend, dass beide Destinationen im Engadin, bei uns, liegen. Alles eine Frage der Betrachtung.