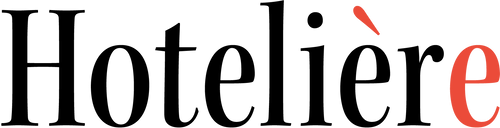Das schweizerische Recht ist vom Grundsatz der Vertragsfreiheit geprägt. Allerdings ist der Spielraum im Arbeitsrecht kleiner als viele meinen. Dieses ist im Unterschied zu anderen Vertragsarten mehr von zwingenden und relativ zwingenden Bestimmungen geprägt. Und es gibt den Art. 341 OR. Er hält fest, dass Mitarbeitende erst ein Monat nach Beendigung der Anstellung auf Ansprüche aus zwingenden Bestimmungen verzichten können.

Die Vertragsfreiheit ist ein hohes Gut und besagt, sobald zwei Parteien etwas vereinbaren, dies auch gelten soll. Dieses Rechtsverständnis ist zu Recht tief in den Köpfen verankert. Sowohl Arbeitgebende wie Angestellte gehen davon aus, dass eine Unterschrift, sobald sie geleistet wurde, ihre Gültigkeit hat. Aus rechtlicher Sicht muss man aber grosse Vorbehalte machen. Das Arbeitsvertragsrecht kennt nämlich sogenannt zwingende und relativ zwingende Vorschriften. Unter zwingenden Bestimmungen versteht man all jene Normen, die weder zugunsten der einen oder anderen Partei abgeändert werden können. Relativ zwingende Bestimmungen sind jene Normen, die nur zugunsten der Arbeitnehmenden angepasst werden können. In den Art. 361 und 362 des Obligationenrechts ist genau aufgelistet, welche Bestimmungen zwingend bzw. relativ zwingend sind. Auch viele Normen des L-GAV dürfen höchstens zugunsten der Arbeitnehmenden abgeändert werden.
Die Unterschrift ist oft nichts wert
Es kommt vor, dass beide Parteien einen Arbeitsvertrag unterzeichnen, in dem beispielsweise die vorgeschriebenen Mindestlöhne des Art. 10 L-GAV nicht eingehalten sind. Wenn irgendwann Arbeitnehmende dies bemerken, so sind sie unsicher, was nun gilt: Ihre Unterschrift oder der L-GAV-Mindestlohn? Die Antwort ist völlig klar: Arbeitnehmende können sogar mit ihrer eigenen Unterschrift nicht tiefere Löhne vereinbaren als im L-GAV vorgesehen. Folge davon ist, dass trotz schriftlicher Vereinbarung jederzeit die Lohndifferenz nachgeklagt werden kann. Dasselbe gilt auch für den Verzicht auf die Überstundenentschädigung. Damit ein solcher gültig wäre, braucht es nach Art. 15 Ziff. 7 L-GAV mindestens einen monatlichen Lohn von CHF 6750 (ohne 13. Monatslohn) sowie eine explizite schriftliche Regelung. Davon gibt es keine Ausnahmen, auch nicht für Kaderangestellte, wie einige wenige immer noch irrtümlich annehmen.
Auch dann, wenn Mitarbeitende bei Vertragsabschluss erkennen, dass der Mindestlohn nicht eingehalten wird und trotzdem den Vertrag unterzeichnen, können sie sich auf zwingende Bestimmungen des Arbeitsrechts berufen. Es gibt keine Pflicht, die Arbeitgeberseite auf die Nichteinhaltung zwingender Bestimmungen aufmerksam zu machen. Denn dann würden sie ja eventuell riskieren, die Stelle nicht zu kriegen.
Verzichtsverbot ausdrücklich geregelt
Im Obligationenrecht steht in Art. 341 OR explizit, dass Arbeitnehmende während der Anstellung sowie ein Monat danach nicht auf Forderungen verzichten können, die «sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder eines GAV ergeben». Am Ende eines Anstellungsverhältnisses werden bekanntermassen Forderungen fällig, beispielsweise aus Ruhetageentschädigungen, aus nicht bezogenen Ferien oder Überstunden.
Arbeitgeberseits wird dann etwa der Vorschlag gemacht, mit einer pauschalen Zahlung alle diesbezüglichen Ansprüche abzugelten. Sogar dann, wenn eine schriftliche Austrittsvereinbarung einvernehmlich verhandelt wird, bleibt das Verzichtsverbot bestehen. Einzig wenn das Anstellungsverhältnis schon ein Monat lang zu Ende ist, besteht wieder «Vertragsfreiheit». Die Frist von einem Monat soll sicherstellen, dass Angestellte nicht unter Druck und mit genügender Distanz entscheiden können. Es sollen aber nicht gerichtliche Vergleiche verunmöglicht werden, weshalb das Verzichtsverbot zeitlich beschränkt ist.
Fünf Jahre Verjährungsfrist
Verschafft man sich einen Überblick über jene Gerichtsverfahren, in denen sich Arbeitnehmende später auf das Verzichtsverbot berufen und nachträglich noch Forderungen stellen, argumentieren Arbeitgebende damit, dass das Zurückkommen auf die getroffene Vereinbarung gegen Treu und Glauben verstossen habe und deshalb rechtsmissbräuchlich sei (Art. 2 ZGB). Nur hören die Gerichte diese Argumente praktisch nie. Innerhalb der Verjährungsfrist (Art. 128 OR) von fünf Jahren können Arbeitnehmende Forderungen einklagen, auf die sie mal verzichtet haben, und erhalten Recht.
Es braucht schon ganz spezielle Umstände, damit die Gerichte eine solche Nachforderung als rechtsmissbräuchlich taxieren. Natürlich kann man arbeitgeberseits darauf spekulieren, dass Mitarbeitende das Verzichtsverbot nicht kennen oder moralische Hemmungen haben, die eigene Unterschrift zu missachten. Aber wie bei jeder Spekulation: Man kann auch verlieren.